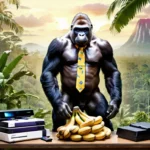Die Magie des Coupe de France: Mehr als nur ein Fußballpokal
Stell dir vor: Ein Wettbewerb, der ganz Fußball-Frankreich vereint, vom kleinsten Amateurklub bis zum glamourösen Starensemble aus Paris. Ein Pokal, bei dem David regelmäßig Goliath herausfordert und manchmal sogar besiegt. Das ist der französische Fußballpokal, die legendäre Coupe de France. Begleite uns auf eine Reise durch die faszinierende Geschichte, die überraschenden Wendungen und die einzigartigen Regeln dieses Wettbewerbs, der seit über einem Jahrhundert die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Bist du bereit, das Geheimnis seines besonderen Flairs zu lüften?
Neben der französischen Meisterschaft ist die Coupe de France der prestigeträchtigste nationale Wettbewerb für Männerfußball-Vereinsmannschaften in Frankreich. Ausgerichtet wird er vom französischen Fußballverband, der FFF (Fédération Française de Football). Es ist mehr als nur ein Turnier; es ist ein Schmelztiegel des französischen Fußballs, eine Bühne für Heldenepen und dramatische Duelle.
Was springt aber für den Sieger heraus, außer Ruhm und Ehre? Auch wenn es den Europapokal der Pokalsieger heute nicht mehr gibt, ist der Gewinn der Coupe de France immer noch ein goldenes Ticket. Der Pokalsieger qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League der folgenden Saison. Ein europäisches Abenteuer winkt! Zudem darf der Gewinner im Spiel um den französischen Supercup, die Trophée des Champions, gegen den amtierenden Meister antreten. Ein weiterer Titel ist also zum Greifen nah.
Die Geburtsstunde: Ein Pokal inmitten des Krieges
Die Geschichte des französischen Pokalwettbewerbs beginnt in einer dunklen Zeit. Mitten im Ersten Weltkrieg, im Jahr 1917, wurde die Coupe de France auf Initiative von Henri Delaunay ins Leben gerufen. Delaunay, später auch Namensgeber des Pokals der Fußball-Europameisterschaft, war Generalsekretär des damaligen Dachverbands CFI (Comité Français Interfédéral). Am 15. Januar 1917 fiel die Entscheidung, am 7. Oktober 1917 fanden die ersten Partien statt. Sieben Monate später, im Mai 1918, stemmte Olympique de Pantin als erster Sieger die Trophäe in die Höhe.
Ursprünglich, und nochmals von 1940 bis 1945 während der deutschen Besatzung, trug der Wettbewerb den Namen Coupe Charles Simon. Damit ehrte man einen im Krieg gefallenen Spieler und Verbandsfunktionär. Das Besondere: Die Coupe de France war der erste landesweite Wettbewerb in Frankreich, der Mannschaften über Verbandsgrenzen hinweg zusammenbrachte. Dies spiegelte das gesellschaftliche Leitmotiv der Union sacrée wider – das Zurückstellen innenpolitischer Streitigkeiten angesichts der nationalen Verteidigung. Die frühen Pokalsieger wurden daher oft auch als französischer Meister (champion de France) angesehen.
Die Anfänge waren bescheiden. Lediglich 48 Vereine nahmen an der ersten Austragung teil. Die Kriegsjahre erschwerten Reisen, viele Spieler waren an der Front, und die Infrastruktur war vielerorts noch unterentwickelt. Doch der Wettbewerb wuchs stetig: 59 Teams im zweiten Jahr, 114 in der ersten Nachkriegssaison und bereits 202 im Jahr 1920/21. Einen wahren Boom gab es nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Marke von 1.000 Teilnehmern wurde erstmals 1950/51 geknackt. Den bisherigen Teilnehmerrekord stellte die Saison 2012/13 mit unglaublichen 7.656 Mannschaften auf – eine Zahl, die auch 2020/21 noch Bestand hatte!
Frühe Jahre und Wachsende Rivalitäten (1917–1945)
Pariser Dominanz trifft auf Widerstand aus dem Süden (1917–1932)
In den ersten Jahren gab die Hauptstadtregion den Ton an. Die ersten sechs Pokalsieger kamen allesamt aus Paris oder dem direkten Umland. Allein Red Star Paris schaffte von 1921 bis 1923 als erster Verein drei Siege in Serie – ein Kunststück, das bis heute nur zwei weitere Klubs wiederholen konnten. Die Hälfte der Teilnehmer der Premierensaison stammte aus dem Großraum Paris, wo auch traditionell die Endspiele stattfanden.
Doch bald erwuchs Konkurrenz aus dem Süden. Es entwickelte sich ein faszinierender Zweikampf zwischen den Pariser Klubs und Teams von der Mittelmeerküste. Allen voran Olympique Marseille (drei Titel zwischen 1924 und 1927) und der FC Sète (vier Finalteilnahmen zwischen 1923 und 1930) forderten die Hauptstadt heraus. Interessanterweise sorgte Sète auch immer wieder für Kontroversen wegen Verstößen gegen die damaligen Amateurbestimmungen. Überraschend schafften es mit AS Valentigney (1926) und US Quevilly (1927) auch zwei Kleinstadtklubs, gestützt durch lokale Industriebetriebe, bis ins Finale.
Professionalismus prägt das Spiel (1932–1945)
Mit der Einführung des Berufsfußballs im Jahr 1932 änderte sich die Landschaft. Die Profivereine, insbesondere die Erstdivisionäre, übernahmen schnell das Kommando. Nur noch zwei unterklassige Teams erreichten in dieser Ära das Finale: Racing Roubaix 1933 und OFC Charleville 1936. Ansonsten dominierten Olympique Marseille (drei Titel, fünf Finals) und Racing Paris (vier Titel) das Geschehen. Auch der FC Sète und Girondins Bordeaux konnten je einen Pokalsieg feiern. Eine Besonderheit stellte das Finale 1944 dar, als sich zwei Regionalauswahlen gegenüberstanden, die aus „bezahlten Staatsamateuren“ bestanden. Das Ende dieser Epoche markierte 1945 die erste Finalteilnahme des neu fusionierten Lille OSC, der die nächste Ära prägen sollte.
Wechselnde Machtverhältnisse und goldene Dekaden (1945–1982)
Das Jahrzehnt des Lille OSC (1945–1955)
Was für eine Serie! Zwischen 1945 und 1949 stand der Lille OSC fünfmal hintereinander im Finale der Coupe de France. Drei dieser Endspiele gewannen die Nordfranzosen in Folge (1946 bis 1948) – ein bis heute unerreichter Rekord an aufeinanderfolgenden Finalsiegen. Auch andere Vereine aus dem Norden und Osten wie Stade Reims und Racing Strasbourg holten den Pokal, während Teams wie Racing Lens, US Valenciennes oder der FC Nancy das Finale erreichten. Der Süden trat in dieser Dekade etwas in den Hintergrund, stellte mit OGC Nizza (zwei Siege) aber immerhin einen Pokalgewinner.
Ein Karussell der Sieger (1955–1965)
Während Stade Reims die heimische Liga dominierte, glich der Pokalwettbewerb einem ständigen Wechselbad der Gefühle. In zehn Jahren gab es acht verschiedene Sieger! Nur die „Arbeiterfußballer“ der UA Sedan-Torcy (zwei Siege bei drei Finalteilnahmen) und die AS Monaco konnten sich doppelt in die Siegerliste eintragen. Ein historischer Moment ereignete sich 1959: Mit dem Le Havre AC gewann erstmals ein Zweitdivisionär die Coupe de France – ein Erfolg, der bis 2009 einzigartig bleiben sollte.
Die Ära Saint-Étienne – und Nantes, Marseille, Lyon (1965–1982)
Parallel zu ihrer Dominanz in der Meisterschaft prägten AS Saint-Étienne und der FC Nantes auch den Pokalwettbewerb, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Saint-Étienne war eine Macht: Bis 1977 gewannen Les Verts alle fünf Finals, die sie erreichten, und standen 1981 sowie 1982 erneut im Endspiel. Nantes hingegen konnte von vier Finalteilnahmen nur die letzte (1979) gewinnen. Daneben glänzten vor allem Olympique Marseille (drei Finals, drei Siege) und Olympique Lyon (zwei Siege in vier Endspielen). Mit der US Orléans schaffte es 1980 auch wieder ein unterklassiges Team ins Finale.
Paris meldet sich zurück und das neue Jahrtausend (1982–Heute)
Paris wird wieder zur „Pokalhauptstadt“ (1982–2000)
Nach über 30 Jahren Durststrecke brachte der erst gut ein Jahrzehnt zuvor gegründete Paris Saint-Germain FC die Trophäe 1982 und 1983 zurück in die Hauptstadt. Bis 1998 folgten drei weitere Triumphe für PSG. Der Klub etablierte sich als neue Pokalmacht. Fünf weitere Vereine sicherten sich in dieser Zeit je zweimal den Pokal: FC Nantes, AS Monaco, FC Metz, Girondins Bordeaux und AJ Auxerre. Olympique Marseille erreichte zwar vier Finals, konnte aber nur 1989 gewinnen.
Dieser Zeitraum sah auch einige der größten Sensationen: 1996 erreichte mit Olympique Nîmes erstmals ein Drittligist das Finale. Im Jahr 2000 schaffte es sogar der viertklassige Calais RUFC bis ins Endspiel – ein wahres Pokalmärchen, auch wenn der letzte Schritt zum großen Triumph verwehrt blieb. Überschattet wurde diese Ära vom Drama von Furiani im Mai 1992. Kurz vor dem Halbfinale zwischen SC Bastia und Marseille stürzte eine Tribüne ein, 18 Menschen starben, über 2.350 wurden verletzt. Der Wettbewerb wurde daraufhin abgebrochen – das einzige Jahr ohne Pokalsieger.
Das 21. Jahrhundert: PSG, Überraschungen und Rekorde
Während Olympique Lyon die Liga jahrelang dominierte, war der Pokal oft unberechenbarer. Lyon selbst gewann ihn „nur“ zweimal (2008, 2012). Paris Saint-Germain und AJ Auxerre wechselten sich häufiger auf der Siegerliste ab. Besondere Momente waren der Sieg des FC Sochaux 2007 (70 Jahre nach ihrem ersten Triumph) und der Erfolg von En Avant Guingamp 2009 in einem rein bretonischen Finale gegen Stade Rennes – ein Duell, das sich 2014 mit demselben Sieger wiederholte.
In den letzten Jahren hat PSG seine Vormachtstellung untermauert, mit einer beeindruckenden Serie von Siegen (2015-2018, 2020, 2021). Doch auch Stade Rennes (2019) und der FC Nantes (2022) konnten die Pariser Dominanz durchbrechen. Immer wieder sorgten auch unterklassige Teams für Furore, wie die US Quevilly, die 2012 als Drittligist das Finale erreichte, oder Les Herbiers VF (ebenfalls Drittligist) 2018. Ein Beleg für die anhaltende Magie des Wettbewerbs!
David gegen Goliath: Die Legende der „Petits Poucets“
Was macht den Reiz der Coupe de France aus? Es ist die Chance für die Kleinen, die Amateure, die „Petits Poucets“ (die kleinen Däumlinge), gegen die großen Profiklubs anzutreten. Die vielleicht berühmteste Überraschung ereignete sich am 4. Februar 1957: Der algerische Amateurverein SCU El Biar traf auf das damalige europäische Spitzenteam Stade de Reims. Reims trat mit fast allen Stars an, doch El Biar siegte sensationell mit 2:0! Eine Geschichte, die bis heute erzählt wird.
Der französische Verband würdigt diese Leistungen sogar mit einer eigenen Wertung, dem „Tableau d’honneur“ (Ehrentafel), die mittlerweile von Sponsoren wie Intermarché unterstützt wird. Hier werden die Amateurvereine gefeiert, die am weitesten kommen – eine Anerkennung für den Kampfgeist der Underdogs.
Wie funktioniert die Coupe de France? Ein Blick auf die Regeln
Du fragst dich, wie dieser riesige Wettbewerb organisiert wird? Hier sind die wichtigsten Punkte:
- Teilnahmepflicht: Nur für die Vereine der obersten fünf Ligen verpflichtend. Viele kleinere Klubs melden sich freiwillig an, sofern ihr Sportplatz die Mindestanforderungen erfüllt.
- Modus: Gespielt wird im K.-o.-System. Eine Niederlage bedeutet das Aus.
- Spielentscheidung: Pro Runde gibt es nur ein Spiel. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt seit der Saison 2020/21 direkt ein Elfmeterschießen – keine Verlängerung mehr!
- Teilnahmeberechtigung: Pro Verein darf nur eine Mannschaft teilnehmen (keine zweiten Mannschaften von Profiklubs).
- Phasen: Der Wettbewerb gliedert sich in eine Vorausscheidungsphase (bis zu 8 Runden) und den Hauptwettbewerb (6 Runden, ab dem Zweiunddreißigstelfinale).
- Auslosung & Setzung:
- Die ersten Runden werden regional ausgelost.
- In den Runden 7, 8 und im Zweiunddreißigstelfinale werden die Teams landesweit in Gruppen ähnlicher Spielstärke aufgeteilt, um zu frühe Duelle der Top-Favoriten zu vermeiden, aber auch um Reisekosten zu optimieren.
- Ab dem Sechzehntelfinale gibt es keine Setzliste mehr – das Los entscheidet alles!
- Einstieg der Profis: Die höherklassigen Vereine steigen erst später ein. Die Klubs der Ligue 2 kommen beispielsweise in der 7. Runde hinzu, die der Ligue 1 traditionell im Zweiunddreißigstelfinale (Runde 9).
Regeländerungen im Wandel der Zeit
Die Coupe de France war nicht immer so, wie wir sie heute kennen. Das Reglement wurde über die Jahrzehnte immer wieder angepasst:
- Paarungsfestlegung: Anfangs legte eine Kommission die Paarungen fest, erst später wurde ausgelost. Zeitweise gab es sogar wieder Setzlisten, um die Profiklubs zu schützen.
- Heimrecht: Die Regeln zur Bestimmung des Heimrechts änderten sich mehrfach.
- Entscheidung bei Unentschieden: Früher gab es Wiederholungsspiele. Später kamen Münzwurf und schließlich das Elfmeterschießen (erstmals im Finale 1982).
- Austragungsorte: Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Hauptrundenspiele oft auf neutralem Platz statt.
- Hin- und Rückspiele: Von 1968/69 bis 1988/89 wurden die Hauptrunden (außer Finale) mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Davon ist man aber wieder abgekommen, um den Pokalcharakter zu stärken.
Finanzen, Fernsehen und das große Finale
Sponsoring und Medienpräsenz
Ein Wettbewerb dieser Größe braucht starke Partner. Unternehmen wie Adidas, Nike, Crédit Agricole, PMU oder Einzelhandelsketten treten als Hauptsponsoren oder offizielle Partner auf und unterstützen den Verband finanziell. Im Gegenzug erhalten sie Werberechte.
Die Fernsehrechte sind heiß begehrt. Sender wie TF1 und Eurosport übertragen die Spiele, insbesondere ab den Hauptrunden. Das Finale erreicht regelmäßig Millionen von Zuschauern (z.B. 6,4 Mio. in der Spitze 2007). Für die übertragenden Sender ist dies eine lukrative Angelegenheit, die durch Werbeblöcke und eigene Übertragungssponsoren refinanziert wird. Natürlich profitieren auch die teilnehmenden Klubs: Neben den geteilten Zuschauereinnahmen erhalten sie ab der 7. Runde Anteile an den Einnahmen der FFF. In der Saison 2020/21 beliefen sich diese Verbandszahlungen an die Vereine auf stattliche 11,93 Millionen Euro.
Die Bühne der Träume: Die Finalorte
Das Finale der Coupe de France ist ein nationales Ereignis. Traditionell findet es in Paris oder dessen unmittelbarem Umland statt. Legendäre Stadien wie der Parc des Princes oder das Stade Olympique Yves-du-Manoir in Colombes waren über Jahrzehnte die Austragungsorte. Seit 1998 ist das imposante Stade de France in Saint-Denis die Heimat des Endspiels.
Eine seltene Ausnahme gab es 2024: Wegen Renovierungsarbeiten für die Olympischen Spiele fand das Finale im Stade Pierre-Mauroy in Lille statt. Eine besondere Tradition seit 1927: Der französische Staatspräsident (oder ein ranghoher Vertreter) wohnt dem Finale bei und übergibt persönlich die Trophäe an den Sieger.
Die Trophäe: Ein silberner Traum
Der Pokal selbst ist ein Kunstwerk. Gestiftet 1918 von Paul Michaux, ist er ein Wanderpokal aus 3,2 Kilogramm Silber, 48 Zentimeter hoch und kunstvoll verziert. Hergestellt wurde er vom renommierten Pariser Goldschmied Adrien Chobillon, der auch den Henri-Delaunay-Pokal für die EM schuf. Der Korpus trägt Inschriften zum Gedenken an Charles Simon und den Stifter.
Die Namen der Siegervereine werden auf Plaketten am schweren Marmorsockel (15 kg) eingraviert, der jedoch nur beim Finale zur Präsentation dient. Seit 1967 erhält der siegreiche Verein eine exakte Kopie des Originals sowie ein verkleinertes Modell für die eigene Trophäensammlung. Die Spieler beider Finalisten bekommen zudem Erinnerungsmedaillen.
Rekorde, Zahlen und unvergessene Helden
Die über 100-jährige Geschichte der Coupe de France ist reich an Rekorden und bemerkenswerten Statistiken.
Vereine im Fokus
- Rekordsieger: Unangefochten an der Spitze thront Paris Saint-Germain mit 15 Titeln, gefolgt von Olympique Marseille mit zehn Erfolgen.
- Häufigste Finalpaarungen: Viermal standen sich Marseille und Bordeaux gegenüber, dreimal Monaco und PSG.
- Titelverteidigungen: Acht Vereine konnten ihren Titel verteidigen. Red Star (1921-23), OSC Lille (1946-48) und Paris Saint-Germain (2015-18) schafften es sogar dreimal bzw. viermal (PSG) in Folge.
- Unterklassige Finalisten: 18 Mal stand ein Team aus einer unteren Liga im Finale. Nur zwei gewannen: Le Havre AC (1959) und En Avant Guingamp (2009), beide als Zweitligisten. Der Viertligist Calais RUFC (2000) und mehrere Drittligisten kamen dem Pokalsieg ebenfalls sehr nahe.
- Finalserien: Nur Lille (1945-49) und PSG (2015-19) schafften fünf Finalteilnahmen in Folge.
- Das Double: Das Kunststück, Meisterschaft und Pokal (Doublé) im selben Jahr zu gewinnen, gelang bisher zwölf Klubs, darunter mehrmals Saint-Étienne und PSG.
- Pokalsieg und Abstieg: Ein seltenes und bitteres Schicksal ereilte vier Klubs: Saint-Étienne (1962), Nizza (1997), Strasbourg (2001) und Lorient (2002) gewannen den Pokal und stiegen im selben Jahr ab.
Spieler, Trainer und Schiedsrichter der Rekorde
- Rekordspieler (Titel): Mit je fünf Pokalsiegen führen Marceau Somerlinck (Lille), Dominique Bathenay (Saint-Étienne, PSG) und Alain Roche (Bordeaux, PSG) die Liste an.
- Rekordspieler (Finals): Somerlinck stand sogar sechsmal im Finale, ebenso wie seine Lille-Kollegen Jean Baratte und Joseph Jadrejak.
- Rekordtorschützen (Finals): Emmanuel Aznar, Jules Dewaquez und Roger Vandooren trafen je viermal in Endspielen. Éric Pécout und Jean-Pierre Papin gelangen je drei Tore in einem einzigen Finale.
- Rekordtorschütze (Einzelspiel): Stefan „Stanis“ Dembicki erzielte 1943 unglaubliche 16 Tore für Racing Lens beim 32:0-Sieg gegen einen Amateurklub.
- Rekordtrainer: André Cheuva (Lille) und der legendäre Guy Roux (Auxerre) gewannen den Pokal je viermal als Trainer.
- Rekordschiedsrichter: Michel Vautrot leitete fünf Endspiele. 2022 pfiff mit Stéphanie Frappart erstmals eine Frau das Finale.
Europäische Ambitionen nach dem Pokalsieg
Der Gewinn der Coupe de France öffnete lange Zeit das Tor zum Europapokal der Pokalsieger (bis 1998) und danach zum UEFA-Pokal bzw. der heutigen UEFA Europa League. Doch der große internationale Erfolg blieb den französischen Pokalsiegern meist verwehrt. In fast 50 Teilnahmen an europäischen Wettbewerben erreichten nur elf Klubs das Viertelfinale, sieben scheiterten im Halbfinale. Lediglich dreimal stand ein französischer Pokalsieger in einem europäischen Endspiel, wobei nur Paris Saint-Germain 1996 den Pokalsieger-Wettbewerb gewinnen konnte. Eine Phase größeren Erfolgs gab es zwischen den späten 1970ern und Mitte der 1990er Jahre.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der französische Fußballpokal ist weit mehr als nur ein Turnier. Er ist ein Symbol für die Einheit des französischen Fußballs, eine Bühne für unvergessliche Dramen und Sensationen. Von seiner Gründung inmitten des Krieges bis zu den modernen Duellen im Stade de France verkörpert die Coupe de France den Traum, dass jeder, egal wie klein, den Gipfel erreichen kann. Ein Wettbewerb mit Herz, Seele und unendlicher Spannung.
1. Was ist die Coupe de France eigentlich?
Es ist der prestigeträchtigste nationale Pokalwettbewerb für Männerfußball-Vereinsmannschaften in Frankreich, ausgerichtet vom französischen Fußballverband (FFF). Das Besondere: Er vereint Teams aller Spielklassen, vom kleinsten Amateurklub bis zu den Profis der Ligue 1.
2. Was springt für den Sieger der Coupe de France heraus?
Neben Ruhm und Ehre qualifiziert sich der Pokalsieger direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League der nächsten Saison. Außerdem darf der Gewinner im Spiel um den französischen Supercup, die Trophée des Champions, gegen den amtierenden Meister antreten.
3. Wann wurde der Wettbewerb gegründet?
Die Coupe de France wurde mitten im Ersten Weltkrieg, im Jahr 1917, auf Initiative von Henri Delaunay ins Leben gerufen. Die Entscheidung fiel am 15. Januar 1917, die ersten Partien fanden am 7. Oktober 1917 statt. Der erste Sieger war Olympique de Pantin im Mai 1918.
4. Wie funktioniert die Coupe de France? Was sind die wichtigsten Regeln?
Gespielt wird im reinen K.-o.-System, eine Niederlage bedeutet das Aus. Pro Runde gibt es nur ein Spiel. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt seit der Saison 2020/21 direkt ein Elfmeterschießen (keine Verlängerung). Die Profiteams steigen erst in späteren Runden ein:
- Ligue 2 Teams starten in Runde 7.
- Ligue 1 Teams starten traditionell im Zweiunddreißigstelfinale (Runde 9).
5. Gab es schon große Überraschungen durch Amateurteams?
Ja, das ist die Essenz des Pokals! Die „Petits Poucets“ (kleine Däumlinge) sorgen immer wieder für Furore. Die berühmteste Sensation war wohl der Sieg des algerischen Amateurvereins SCU El Biar gegen das Top-Team Stade de Reims 1957. Aber auch der Finaleinzug des Viertligisten Calais RUFC im Jahr 2000 oder der Drittligisten US Quevilly (2012) und Les Herbiers VF (2018) sind legendär.
Du möchtest mehr über Französischer Fußballpokal wissen?
Diese Seite basiert unter anderem auf Französischer Fußballpokal aus der Wikipedia (abgerufen am 1. April 2025) und wurde automatisch mit KI weiterverarbeitet.