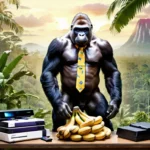Bühne frei für den deutschen Fußball-Wahnsinn! Hast du dich jemals gefragt, was den DFB-Pokal zum vielleicht spannendsten und emotionalsten Wettbewerb im deutschen Fußball macht? Es ist mehr als nur ein Turnier; es ist ein jährliches Drama voller unerwarteter Helden, bitterer Niederlagen und unvergesslicher Momente. Seit 1935 fesselt dieser nationale Pokalwettbewerb Millionen von Fans, direkt nach der Meisterschaft der wichtigste Titel, um den die Vereine kämpfen. Im K.-o.-System kann jeder jeden schlagen – der Underdog den haushohen Favoriten, der Amateur den Profi. Genau das ist der Stoff, aus dem Legenden sind! Begleite uns auf eine Reise durch die faszinierende Geschichte, die packenden Regeln und die unzähligen Geschichten, die den DFB-Pokal zu einem echten Highlight im Fußballjahr machen. Bist du bereit für Gänsehautmomente und pure Pokal-Leidenschaft?
Die Wurzeln: Vom Tschammerpokal zum DFB-Pokal
Alles begann 1935, allerdings unter einem anderen Namen: dem Tschammerpokal. Benannt nach dem damaligen Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, war dieser Wettbewerb der direkte Vorgänger des heutigen DFB-Pokals. Stell dir vor, über 4000 Mannschaften nahmen am ersten Turnier teil! Eine riesige Zahl, die zeigt, wie groß die Fußballbegeisterung schon damals war. Das Ziel war klar: einen nationalen Pokalsieger zu küren, ähnlich wie im englischen Fußball mit dem traditionsreichen FA Cup, der ja schon seit 1872 existiert.
Der Modus sah Vor-, Zwischen- und Hauptrunden vor, die schließlich im großen Endspiel gipfelten. Das allererste Finale fand am 8. Dezember 1935 im Düsseldorfer Rheinstadion statt. Wer stand sich gegenüber? Der FC Schalke 04 und der damalige Rekordmeister 1. FC Nürnberg. Die Nürnberger setzten sich mit 2:0 durch und sicherten sich den ersten Titel. Der Pokal selbst war als Wanderpokal konzipiert, der erst nach dreimaligem Gewinn in Folge oder viermaligem Gesamtsieg in den Besitz eines Vereins übergehen sollte – eine Regelung, die heute anders ist.
Die dunklen Jahre des Zweiten Weltkriegs warfen jedoch bald ihre Schatten voraus. 1943 wurde der Tschammerpokal zum letzten Mal ausgetragen. In einem Finale, das in der Stuttgarter Adolf-Hitler-Kampfbahn stattfand, siegte die Vienna aus Wien gegen den Luftwaffen-Sportverein Hamburg. Danach legte der Krieg den Wettbewerb lahm – bis 1952.
Neuanfang nach dem Krieg
Nach dem Krieg war es der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der den nationalen Vereinspokal 1952 für Westdeutschland wieder ins Leben rief. Zunächst noch als DFB-Vereinspokal bezeichnet, wurde er zum Vorläufer des heutigen DFB-Pokals. Interessanterweise diente anfangs noch die alte Trophäe des Tschammerpokals als Siegerpreis, allerdings wurde das Hakenkreuz durch eine Platte mit dem DFB-Symbol ersetzt – ein klares Zeichen des Neuanfangs. Diese geschichtsträchtige Trophäe kannst du übrigens seit 2015 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bestaunen.
Den ersten Pokal nach dem Krieg sicherte sich Rot-Weiss Essen im Jahr 1953 mit einem 2:1-Sieg gegen Alemannia Aachen in Düsseldorf. Eine interessante Phase folgte von 1956 bis 1963, als der Wettbewerb komplett innerhalb eines Kalenderjahres ausgespielt wurde. In dieser Zeit gab es neun verschiedene Sieger, nur der Karlsruher SC und der VfB Stuttgart konnten den Titel je zweimal holen. Eine echte Sensation gelang Schwarz-Weiß Essen 1959: Als Außenseiter schlugen sie im Halbfinale den großen Hamburger SV und gewannen das Finale gegen Borussia Neunkirchen deutlich mit 5:2. Solche Geschichten machen den Pokal aus, findest du nicht auch?
Der moderne DFB-Pokal: Glanzlichter und Dramen seit 1963
Ein Meilenstein in der deutschen Fußballgeschichte war die Einführung der Bundesliga im Jahr 1963. Das hatte auch direkte Auswirkungen auf den DFB-Pokal: Die Bundesligisten waren nun automatisch für den Wettbewerb qualifiziert. Gleichzeitig wurde der Pokal wieder mit der Saison synchronisiert, das Finale fand fortan als krönender Abschluss im Mai oder Juni statt.
Frühe Überraschungen und Dominanz
Die neue Ära startete gleich mit Paukenschlägen. In der Saison 1965/66 holte der gerade aufgestiegene FC Bayern München überraschend den Pokal. Auf dem Weg dorthin schalteten sie in der Qualifikationsrunde den Titelverteidiger Borussia Dortmund aus – jenen BVB, der im selben Jahr als erster deutscher Verein einen Europapokal gewann! Die Bayern wiederholten ihren Triumph im Jahr darauf. Nach einem Kölner Sieg 1968 (gegen den damaligen Regionalligisten VfL Bochum) holten die Münchner 1969 bereits ihren vierten Pokalsieg.
Doch es waren nicht nur die Großen, die glänzten. 1970 sorgten die Offenbacher Kickers für Furore, als sie als erster Zweitligist den Pokal gewannen! Kurios: Wegen der WM 1970 in Mexiko wurden die entscheidenden Runden erst nach dem Turnier im Sommer ausgetragen. Und wer erinnert sich nicht an das denkwürdige Finale von 1973 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln? Im Mittelpunkt stand Günter Netzer, der kurz vor seinem Wechsel zu Real Madrid stand und sich in der Verlängerung quasi selbst einwechselte, um dann das Siegtor zu erzielen – pure Pokalgeschichte!
Die Ära der „Pokalmannschaften“ und Regeländerungen
Mit der Einführung der zweigeteilten 2. Bundesliga 1974/75 änderte sich auch das Qualifikationssystem. Neben den Profi-Mannschaften waren nun die Landesverbände dafür zuständig, über ihre Verbandspokale die Amateurvertreter zu ermitteln. Das öffnete die Tür für noch mehr potenzielle „David gegen Goliath“-Duelle.
Die späten 1970er Jahre sahen einige Teams, die sich als echte „Pokalmannschaften“ etablierten. Eintracht Frankfurt triumphierte 1974 und 1975, der Hamburger SV holte den Pott 1976, und der 1. FC Köln schaffte 1978 sogar das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg, nachdem sie den Titel bereits 1977 gewonnen hatten. Besonders im Gedächtnis blieb auch Fortuna Düsseldorf. Nach fünf (!) Finalniederlagen (1937, 1957, 1958, 1962, 1978) gelang ihnen 1979 endlich der ersehnte erste Pokalsieg durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen Hertha BSC. Diesen Erfolg wiederholten sie 1980 mit einem 2:1 gegen Köln. Die Fortuna erreichte sogar das Finale im Europapokal der Pokalsieger.
Ab der Saison 1982/83 wurde das Teilnehmerfeld auf 64 Mannschaften reduziert – die 36 Erst- und Zweitligisten sowie 28 weitere Vereine (später angepasst). Ein Kuriosum gab es 1983: Im Finale im Kölner Müngersdorfer Stadion trafen mit dem Bundesligisten 1. FC Köln und dem Zweitligisten SC Fortuna Köln zwei Teams aus derselben Stadt aufeinander – der „Effzeh“ gewann 1:0. Ein Jahr später, 1984, gab es die nächste Premiere: Erstmals wurde ein DFB-Pokalfinale im Elfmeterschießen entschieden. Bayern München gewann gegen Borussia Mönchengladbach, nachdem ausgerechnet Gladbachs Lothar Matthäus, der vor einem Wechsel zu den Bayern stand, den ersten Elfmeter verschoss.
Das Finale in Berlin: Ein fester Termin im Fußballkalender
Seit 1985 hat der DFB-Pokal sein festes Zuhause für das große Finale: das Olympiastadion Berlin. Zuvor wurde der Endspielort eher kurzfristig festgelegt, oft abhängig von der geografischen Lage der Finalisten. Hannover war bis dahin der häufigste Austragungsort. Die Entscheidung für Berlin war anfangs nicht unumstritten, vor allem wegen der politischen Lage im geteilten Deutschland und der notwendigen Transitreisen durch die DDR.
Doch die Bedenken erwiesen sich als unbegründet. Das Olympiastadion entwickelte sich schnell zum „deutschen Wembley“, einem magischen Ort für Spieler und Fans. Der Schlachtruf „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ ist heute aus keiner Fankurve mehr wegzudenken, wenn der eigene Verein im Pokal weit kommt. Die Finals sind regelmäßig ausverkauft, die Nachfrage nach Tickets übersteigt das Angebot bei Weitem. Die Atmosphäre ist einzigartig, ein echtes Fußballfest. Der Vertrag mit Berlin wurde zuletzt bis Ende 2025 verlängert – die Hauptstadt bleibt das Zentrum des deutschen Pokalfußballs.
Wiedervereinigung und neue Teilnehmer
Die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989 fiel zufällig auf den Tag der Achtelfinalspiele des DFB-Pokals 1989/90 – ein historischer Moment, der auch den Fußball prägen sollte. Obwohl die Saison 1990/91 noch ohne ostdeutsche Vereine stattfand (Werder Bremen besiegte Köln im Elfmeterschießen), änderte sich das ab 1991/92 grundlegend. Die Vereine aus den neuen Bundesländern nahmen erstmals am gesamtdeutschen Pokalwettbewerb teil.
Und gleich im ersten Jahr mit ostdeutscher Beteiligung gab es die nächste Sensation: Der Zweitligist Hannover 96 gewann 1992 das Finale gegen Borussia Mönchengladbach im Elfmeterschießen! Bis heute ist das der einzige Pokalsieg eines Vereins, der nicht der ersten Bundesliga angehörte (Kickers Offenbach war bei ihrem Sieg 1970 zwar Zweitligist, aber bereits als Aufsteiger feststehend). Zwischen 1992 und 2011 schafften es zwar noch sieben weitere unterklassige Teams ins Finale (u.a. Energie Cottbus 1997), aber nur Hannover konnte den Pott auch holen.
Die Jahre bis 2011 waren ansonsten oft von der Dominanz bestimmter Klubs geprägt, insbesondere Bayern München, FC Schalke 04 und Werder Bremen teilten viele Titel unter sich auf. Eine unrühmliche Episode gab es im November 2011, als Dynamo Dresden wegen Fan-Ausschreitungen für den Pokalwettbewerb 2012/13 ausgeschlossen wurde.
Die letzten Jahrzehnte: Titelkämpfe und neue Herausforderer
Die 2010er Jahre standen im DFB-Pokal oft im Zeichen des Duells zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. 2012 holte der BVB das Double mit einem furiosen 5:2-Sieg gegen die Bayern. 2013 revanchierten sich die Bayern im Viertelfinale auf dem Weg zum Triple. 2014 gewannen wieder die Bayern das Finale gegen Dortmund (2:0 n.V.) und holten ihr 10. Double. 2015 siegte Dortmund im Halbfinale nach einem kuriosen Elfmeterschießen, unterlag dann aber im Finale dem VfL Wolfsburg, der seinen ersten Pokalsieg feierte.
2016 standen sich Bayern und Dortmund erneut im Finale gegenüber – wieder mit dem besseren Ende für die Münchner im Elfmeterschießen. 2017 dann der BVB: Sieg im Finale gegen Eintracht Frankfurt, nachdem man im Halbfinale die Bayern bezwungen hatte. Von 2012 bis 2018 trafen die beiden Topklubs jedes Jahr im Pokal aufeinander! 2018 schaffte es Eintracht Frankfurt erneut ins Finale und triumphierte überraschend mit 3:1 gegen die Bayern – der erste Pokaltitel für die Hessen nach 30 Jahren.
Nach zwei weiteren Bayern-Siegen (2019, 2020) und einem Dortmunder Erfolg (2021) etablierte sich mit RB Leipzig ein neuer starker Konkurrent, der 2022 und 2023 zweimal in Folge den Pokal gewann, nachdem sie zuvor schon 2019 und 2021 im Finale gestanden hatten. Im Januar 2024 schlug Berti Vogts nach dem Tod von Franz Beckenbauer vor, den Pokal zu Ehren der Legende umzubenennen – eine Idee, die diskutiert wird. Die jüngste Ausgabe, die 81. Austragung in der Saison 2023/24, sah Bayer 04 Leverkusen als Sieger. Im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern holten sie ihren zweiten Pokalsieg und machten damit sogar das erste ungeschlagene Double der deutschen Fußballgeschichte perfekt!
Wie funktioniert der DFB-Pokal? Modus, Regeln und Teilnehmer
Du fragst dich, wie genau der Weg zum Pokalhelden aussieht? Die Grundregeln sind einfach, aber die Details machen die Spannung aus.
Spielregeln: K.-o.-System und Besonderheiten
Das Herzstück des DFB-Pokals ist das K.-o.-System. Jedes Spiel ist ein Endspiel – der Sieger kommt weiter, der Verlierer ist raus. Die reguläre Spielzeit beträgt 2 x 45 Minuten. Steht es danach unentschieden, geht es in die Verlängerung (2 x 15 Minuten). Gibt es auch dann noch keinen Sieger, entscheidet das dramatische Elfmeterschießen.
Interessant: Früher gab es bei Unentschieden nach Verlängerung (bis 1991) ein Wiederholungsspiel, bei dem das Heimrecht wechselte. Nur wenn auch das Wiederholungsspiel unentschieden endete, kam es zum Elfmeterschießen. Eine kuriose Ausnahme gab es 1971/72 und 1972/73, als der Pokal sogar mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wurde!
Seit der Saison 1991/92 wird in jeder Runde bei Gleichstand nach Verlängerung sofort das Elfmeterschießen durchgeführt. Im Finale war dies bisher sechsmal der Fall (1984, 1991, 1992, 1999, 2016, 2022). Vier weitere Endspiele wurden „nur“ in der Verlängerung entschieden (1979, 2007, 2008, 2014).
Neuere Regeln umfassen seit 2016/17 die Möglichkeit einer vierten Auswechslung in der Verlängerung und seit 2017/18 den Einsatz des Video-Assistenten (VAR) zur Unterstützung der Schiedsrichter.
Wer darf teilnehmen? Der Weg in die erste Runde
Wer ist überhaupt dabei? Insgesamt starten 64 Mannschaften in die erste Hauptrunde. Dazu gehören:
- Alle 18 Vereine der Bundesliga der Vorsaison.
- Alle 18 Vereine der 2. Bundesliga der Vorsaison.
- Die vier bestplatzierten Mannschaften der 3. Liga der Vorsaison.
- 24 Mannschaften aus den unteren Ligen. Diese qualifizieren sich in der Regel als Sieger der Verbandspokale der 21 Landesverbände des DFB. Die drei mitgliederstärksten Landesverbände (Bayern, Niedersachsen, Westfalen) dürfen sogar jeweils einen zweiten Vertreter entsenden.
Wichtig: Zweitmannschaften von Profiklubs (z.B. FC Bayern II) dürfen nicht am DFB-Pokal teilnehmen.
Die Auslosung: Töpfe, Heimrecht und Spannung
Die Auslosung sorgt immer wieder für Zündstoff und Traumlose. Für die erste Runde gibt es zwei Lostöpfe:
- Topf 1: Die 18 Bundesligisten und die 14 bestplatzierten Zweitligisten der Vorsaison.
- Topf 2: Die 4 letztplatzierten Zweitligisten, die 4 besten Drittligisten und die 24 Vertreter aus den Landesverbänden (Amateure).
Der Clou: Mannschaften aus Topf 2 haben gegen Mannschaften aus Topf 1 automatisch Heimrecht! Das ist die Grundlage für viele der legendären Pokalsensationen, wenn der „kleine“ Verein den „großen“ Favoriten im eigenen Stadion empfängt. Ein Tausch des Heimrechts ist normalerweise nicht erlaubt (Ausnahme war die Corona-Saison 2020/21).
Auch in der zweiten Runde gibt es zwei Töpfe (Profi-Topf vs. Rest), wobei Amateurvereine oder Drittligisten weiterhin Heimrecht gegen Erst- und Zweitligisten genießen. Ab dem Achtelfinale wird nur noch aus einem Topf gelost, aber das Heimrecht für unterklassige Teams gegen Profis bleibt bestehen.
Die Auslosungen finden seit einigen Jahren meist am Sonntag nach der jeweiligen Pokalrunde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und werden live in der ARD Sportschau übertragen – ein fester Termin für Fußballfans!
Mehr als nur Metall: Die DFB-Pokal-Trophäe
Der Pokal selbst ist natürlich das Objekt der Begierde. Die heutige Trophäe, die jeder Kapitän nach dem Sieg in den Berliner Nachthimmel reckt, wurde 1964 vom Kölner Künstler Wilhelm Nagel geschaffen. Sie löste den modifizierten Tschammerpokal ab.
Als erste Mannschaft durfte Borussia Dortmund den neuen Pokal nach einem 2:0 gegen Alemannia Aachen 1965 in Empfang nehmen. Die Daten sind beeindruckend:
- Höhe: ca. 52 Zentimeter
- Gewicht: 5,7 Kilogramm
- Material: Sterlingsilber, feuervergoldet mit 250 Gramm Feingold
- Verzierung: 12 Turmaline, 12 Bergkristalle, 18 Nephrite
- Kernstück: Das DFB-Emblem aus grünem Nephrit
- Fassungsvermögen: Acht Liter (genug für eine ordentliche Siegerdusche!)
Der Sockel bietet Platz für die Gravuren der Sieger. Bis 1991 war der Platz fast voll, sodass die Basis um fünf Zentimeter erhöht werden musste, um Raum für zukünftige Champions zu schaffen. Der materielle Wert wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt, doch der ideelle Wert dieses Einzelstücks ist natürlich unbezahlbar.
Was bringt der Pokalsieg? Preisgeld und Europa League
Neben Ruhm und Ehre geht es im DFB-Pokal auch um handfeste Vorteile. Jeder Teilnehmer erhält schon in der ersten Runde eine stattliche Summe aus den TV-Einnahmen (in der Saison 2022/23 waren es über 200.000 Euro). Mit jeder erreichten Runde verdoppelt sich dieser Betrag fast. Die Halbfinalisten kassieren über 3 Millionen Euro, die Prämien für die Finalisten kommen noch obendrauf.
Dazu kommen die Zuschauereinnahmen aus den Heimspielen, die (abzüglich 10% für den DFB) zu je 45% zwischen Heim- und Gastverein geteilt werden.
Und sportlich? Der DFB-Pokalsieger qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League. Ein attraktives Ticket für den internationalen Wettbewerb! Früher (bis 1998) führte der Pokalsieg in den Europapokal der Pokalsieger, den deutsche Teams wie Dortmund, Bayern, Hamburg und Bremen gewinnen konnten.
Was passiert, wenn der Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Champions League oder Europa League qualifiziert ist? Früher rückte dann der unterlegene Finalist nach. Diese Regel wurde jedoch von der UEFA geändert. Heute ist es zwingend notwendig, den Pokal zu gewinnen, um sich über diesen Weg international zu qualifizieren. Ist der Sieger bereits qualifiziert, geht der Europa-League-Startplatz nicht an den Finalverlierer, sondern an den nächstbesten, noch nicht international qualifizierten Verein der Bundesliga-Tabelle (aktuell der Tabellensiebte, der dann in den Playoffs zur Europa Conference League startet).
Rekorde, Legenden und unvergessliche Momente
Der DFB-Pokal hat über die Jahrzehnte unzählige Helden hervorgebracht und für Rekorde gesorgt, die teilweise für die Ewigkeit scheinen.
Die erfolgreichsten Vereine und Spieler
Wer hat den Pokal am häufigsten gewonnen? Hier ist die Antwort wenig überraschend:
- FC Bayern München: 20 Titel (alleiniger Rekordsieger seit 1969)
- Werder Bremen: 6 Titel
- FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt: je 5 Titel
- 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg: je 4 Titel
Insgesamt konnten 26 verschiedene Vereine den Pokal gewinnen. Sechs Mannschaften schafften das Kunststück, im selben Jahr Meister und Pokalsieger zu werden (das Double): Schalke 04 (1937), Bayern München (sagenhafte 13 Mal!), 1. FC Köln (1978), Werder Bremen (2004), Borussia Dortmund (2012) und Bayer Leverkusen (2024 – als erstes Team ungeschlagen).
Die häufigste Finalpaarung ist Bayern gegen Dortmund (viermal, 3:1 Siege für Bayern). Niemand konnte bisher dreimal in Folge gewinnen, aber Dortmund schaffte es viermal hintereinander ins Finale (2014-2017), verlor jedoch die ersten drei.
Bei den Spielern thront Bastian Schweinsteiger mit sieben Pokalsiegen an der Spitze, gefolgt von Legenden wie Oliver Kahn, Philipp Lahm, Thomas Müller und Manuel Neuer mit jeweils sechs Titeln. Rekordspieler ist Mirko Votava mit 79 Einsätzen (für Dortmund und Bremen). Und wer schoss die meisten Tore? Natürlich Gerd Müller – unfassbare 78 Tore in nur 62 Pokalspielen für den FC Bayern!
Trainerlegenden am Spielfeldrand
Auch auf der Trainerbank gibt es Rekordhalter. Karl-Heinz Feldkamp, Hennes Weisweiler, Ottmar Hitzfeld, Udo Lattek, Otto Rehhagel und Thomas Schaaf haben den Pokal jeweils dreimal gewonnen. Besonders bemerkenswert sind diejenigen, die sowohl als Spieler als auch als Trainer erfolgreich waren, wie Jupp Heynckes, Niko Kovač, Hansi Flick und zuletzt Xabi Alonso (2024 mit Leverkusen nach seinem Spielertitel 2016 mit Bayern). Thomas Schaaf ist der Einzige, der in beiden Rollen sogar mehrfach triumphierte (als Spieler und Trainer mit Werder Bremen).
Pokalüberraschungen: Wenn David Goliath besiegt
Was wäre der Pokal ohne seine Überraschungen? Die oft zitierte Floskel „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“ kommt nicht von ungefähr. Gemeint ist die einzigartige Chance für unterklassige Mannschaften, die großen Favoriten zu ärgern oder gar rauszuwerfen.
Der bereits erwähnte Sieg von Hannover 96 1992 als Zweitligist ist das ultimative Beispiel. Aber auch andere haben für Furore gesorgt: Kickers Offenbach (Sieg 1970), Alemannia Aachen (Finale 1965 & 2004), Energie Cottbus (Finale 1997), Union Berlin (Finale 2001), MSV Duisburg (Finale 1998 & 2011). Unvergessen auch der Durchmarsch von Arminia Bielefeld (damals 3. Liga) ins Halbfinale 2014/15 nach Siegen gegen drei Bundesligisten.
Der absolute Höhepunkt für Amateure war wohl der 1. FC Saarbrücken: 2019/20 erreichten sie als erster Viertligist (!) das Halbfinale. Und 2023/24 wiederholten sie als Drittligist dieses Kunststück, nachdem sie auf dem Weg dorthin unter anderem den Rekordsieger FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach eliminiert hatten! Solche Geschichten schreibt nur der Pokal.
Natürlich gibt es auch die Kehrseite: bittere Niederlagen für die Favoriten. Eintracht Frankfurt kassierte 2000/01 ein 1:6 gegen die Amateure des VfB Stuttgart. Hoffenheim verlor 2012/13 0:4 gegen den Viertligisten Berliner AK 07. Selbst die Bayern mussten sich mehrmals geschlagen geben, etwa 1994/95 gegen den TSV Vestenbergsgreuth oder 2020/21 gegen Holstein Kiel (damals 2. Liga) und eben 2023/24 gegen Saarbrücken.
Live dabei: Der DFB-Pokal im Fernsehen
Willst du die Spannung live miterleben? Alle Spiele des DFB-Pokals werden seit Jahren vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Doch auch im Free-TV gibt es regelmäßig ausgewählte Top-Spiele zu sehen, traditionell in der ARD und bei Sport1. Die Live-Übertragung der Auslosungen in der Sportschau aus dem Deutschen Fußballmuseum gehört ebenfalls zum festen Programm.

Der DFB-Pokal ist und bleibt ein Herzstück des deutschen Fußballs. Er verkörpert wie kein anderer Wettbewerb den Traum vom Unmöglichen, die pure Emotion und die Chance für jeden Verein, Geschichte zu schreiben. Vom dramatischen K.-o.-Modus über das magische Finale in Berlin bis zu den unzähligen Heldengeschichten – hier lebt der Fußball in seiner ursprünglichsten Form. Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze.
5 Fragen zum DFB-Pokal
1. Wann begann der DFB-Pokal und wie hieß er früher?
Der Wettbewerb begann 1935 als Tschammerpokal, benannt nach dem damaligen Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten. Das erste Finale gewann der 1. FC Nürnberg. Nach einer Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg wurde er 1952 für Westdeutschland als Vorläufer des heutigen DFB-Pokals wiederbelebt.
2. Wie funktioniert der K.o.-Modus im DFB-Pokal?
Das Herzstück ist das K.o.-System: Der Sieger kommt weiter, der Verlierer ist raus. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt eine Verlängerung (2 x 15 Minuten). Gibt es dann immer noch keinen Sieger, entscheidet das Elfmeterschießen. Früher (bis 1991) gab es stattdessen Wiederholungsspiele.
3. Wer darf am DFB-Pokal teilnehmen?
Insgesamt starten 64 Mannschaften in die erste Hauptrunde. Dazu gehören:
- Alle 18 Vereine der Bundesliga der Vorsaison.
- Alle 18 Vereine der 2. Bundesliga der Vorsaison.
- Die vier bestplatzierten Mannschaften der 3. Liga der Vorsaison.
- 24 Mannschaften aus den unteren Ligen, die sich meist über die Verbandspokale qualifizieren.
Wichtig: Zweitmannschaften von Profiklubs dürfen nicht teilnehmen.
4. Wo findet das DFB-Pokalfinale statt?
Seit 1985 hat das Finale sein festes Zuhause im Olympiastadion Berlin. Dieser Ort hat sich zum „deutschen Wembley“ entwickelt und der Vertrag mit Berlin wurde bis Ende 2025 verlängert.
5. Was erhält der DFB-Pokalsieger außer der Trophäe?
Neben Ruhm, Ehre und der begehrten Trophäe gibt es für jede erreichte Runde erhebliches Preisgeld aus TV- und Zuschauereinnahmen. Sportlich qualifiziert sich der DFB-Pokalsieger direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League.